Zum 70. Geburtstag von Thomas Hürlimann, dem bedeutendsten Schweizer Schriftsteller der Gegenwart, unternahm ich mit ihm eine Fahrt ins Herz der Eidgenossen.
Die wichtigste Voraussetzung zur Lektüre von Thomas Hürlimann, diesem Levitationskünstler ersten Ranges, ist eine ganz spezifische Schwindelfreiheit. Es scheint dem Leser, als wolle bei ihm jedes Wort nach oben, weil es dort offen ist, und so heiter und so unwahrscheinlich blau wie der Himmel über den Schwyzer Mythen am Vierwaldstätter See.
Er erreicht dieses Schweben mit den konventionellsten Mitteln, wie Realismus, Groteske, Plot, Überraschung, Figurenfülle, Humor, vor allem dem, versuchen Sie es, lesen Sie die Wirtschaftswunder-Komödie „Vierzig Rosen“ oder die Geruchsorgie „Fräulein Stark“ oder das jüngste Meisterwerk, den Roman „Heimkehr“, er wird Sie, lieber Leser, emporheben und verwandeln.
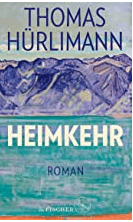
Als ich auf ihn traf in Wien im Juni 2017 anlässlich seiner Poetikvorlesung über das “Kreuz in der modernen Literatur“ wurde er vom Dekan der Theologischen Fakultät mit einem Satz aus Hölderlins Elegie „Brod und Wein“ eingeführt: „So komm! Dass wir das Offene schauen, / Dass es Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.“
Und es verwunderte uns Zuhörer kein bisschen, dass so einer, wie er erzählte, mit der Vertikalen aufwuchs, hinter den spitzen Türmen des Klosters Einsiedeln, wo er im schwarzen Rock ministrierte und seine Gebete vor der schwarzen Madonna im Aroma aus Weihrauch und Kerzenwachs emporsteigen ließ.
Bis er, auch das ein rebellenhaft logischer und lustiger erster Sprung -hinaus statt hinauf!- zum Gründer eines Atheistenclubs wurde, als ihm die Mutter, diesmal die leibliche, eröffnete, dass sie zwei Totgeburten hatte und ihre ungetauften Kinder zwar nicht in der Hölle, aber im unerlösten Limbus vermutete, worunter sie so litt, dass sie weinte. Und Thomas litt mit und fiel aus dem Glauben.
Nicht lange danach fiel er aus dem Unglauben, und das auf Dauer. Die Magie dieses weißstoppeligen Nickelbrillenträgers am Vortragspult dort unten, so klein wie Napoleon, bestand an jenem Juni-Abend in der Anstrengungslosigkeit, mit der er in dien Ursprünge der Philosophiegeschichte führte, die mit Platons Urbildern begann. Erst die Seele und ihre Erinnerungen, dann die Welt, das ist die Reihenfolge. Und heute verdämmern die Seelen.

Hürlimann zitierte aus dem 17.Kapitel von Plutarchs „Der Untergang der Orakel“ jene dramatische Episode um den ägyptischen Kapitän Thamus, dem von den Insulanern aus Taxoi aufgetragen wird, den Einwohnern von Palodes, sollte dort Windstille sein, hinüberzurufen: „Der große Pan ist tot“.
Worauf ein Wehklagen erscholl in der antiken Welt, und ein großes Erschrecken war.
An diesem Abend in Wien hatten wir die empfindungsreichen bronzezeitlichen Menschen vor Augen, in der blauen Ägäis mit ihren Säulentempeln, und dann sprangen wir mit Hürlimann in die abgestumpfte Gottvergessenheit und Bildungszertrümmerung der 68er in Berlin, wo er über zehn Jahre lang Philosophie studierte und als Dramaturg arbeitete, also hin zu jenem innerlichen Epochenriss, jener Seelenlosigkeit, die damals keiner bemerkte, und das war ganz sicher die noch größere Katastrophe.
Anschließend feierten wir mit dem Dekan dessen Geburtstag und stahlen uns weg in ein Wiener Wein-Beisel und tauschten uns aus bis morgens um drei, über die Frauen, die Kirche, die Kindheit, die Indienfahrten, die Sucht, über Berlin, das Theater, und er erzählt von seinen Krebsoperationen, doch jetzt ist alles gut, sagte er.
Und dann verschwindet er für Jahre und ich lese in der Zeitung von erneuten Operationen und Qualen, von einer Odyssee durch Krebskliniken. Doch, typisch Hürlimann, er schreibt darüber nach Art einer unwiderstehlich komischen Restaurantkritik. „Zwei Sterne Abzug für die zu lange Wartezeit und die Architektur. Notaufnahme Zuger Kantonsspital: 1 Stern.“

Und dann fällt mir dieser jüngste voluminöse Roman „Heimkehr“ in die Hände, der mit drei kleinen Punkten, einem Auto-Unfall und einer Amnesie beginnt. Ja, Hürlimann kämpfte nach seinen Krebsoperationen um sein Leben und gleichzeitig um und in diesem Roman, dessen Schlusslektorat er tatsächlich noch in einer Klinik besorgt.
Ein Bildungsroman als existentieller Krimi, er ist nicht Stiller, wie es bei Max Frisch hieß, aber auch noch nicht „Übel“, sein Name im Buch, ein Himmels- und Höllengelächter dringt aus diesem Schmöker im schönsten Sinn, der beginnt wie ein Mafia-Film und dann abhebt mit Halbweltdamen, Zürcher Neurotikern, lauernden Nachbarn, einer DDR-deutschen Handyproduktion samt einer Agentin, die aus den Fluten steigt wie Ursula Andress in James Bonds „Dr.No“, und immer wieder einer sprechenden Katze wie in Bulgakows Roman.
Über allem der ferne Gottähnliche Vater und die Erinnerung an die rätselhaft verunglückte Mutter, die aber eventuell gar nicht tot ist.
Heinrich Übel also, nach dem Schweizer Nationalroman schlechthin, Gottfried Kellers „Der Grüne Heinrich“, genau 150 Jahre später ein erneuter Künstlerroman, wenn man die Magisterarbeit, die dieser Heinrich seinem Unternehmer-Papa, einem Kondom-Hersteller, um nicht zu sagen: Kondom-Herrscher und -Fürsten widmet, als Kunstwerk betrachtet, immerhin über 500 Seiten stark.
Zwölf Jahre hat Hürlimann an dieser Antwort auf Kellers bewundernswertes autobiografisches Erzählmassiv gearbeitet, das seinerseits Goethes Wilhelm Meister Referenz erweist, mit einer tragischen Mignon und bunten Maskeraden, den Turm- oder Ateliergesellschaften, den Geschwisterlieben, Graf und Gräfin, Welttheater und Bildungsroman.

„Heimkehr“ ist Hürlimanns opus magnum, nicht ohne Komik, nicht ohne Heldenmut ruft da einer hoch in die Schweizer Massive: Okay, ich nehme die Herausforderung an, jetzt, heute, zu meinen Bedingungen, im neuen Jahrtausend, mit jenem schwarzen Humor, den es braucht, um es zu überstehen.
Und also antwortete er mit seinem eigenen noch ziemlich grünen Heinrich, seiner eignen Geschichte aus Lied und Traum und Tod.
Wir treffen uns in Zug und fahren gleich hinaus nach Brunnen, (dem Ort des 2.Schweizer Bundes von 1315, nach dem Sieg über die Habsburger), um die Fähre am Vierwaldstätter See zu besteigen und die Wasser-Reise ins Herz der Schweiz anzutreten, die Urkantone Uri und Schwyz und Altendorf, und ihrem Geheimnis auf die Schliche zu kommen, nämlich gleichzeitig Dorf und Welt zu sein.

Grünschillernde Tiefen und grau in den Himmel getürmte Felsbrocken wie auf dem Cover von Hürlimanns „Heimkehr“, kaum ein Prospekt auf unserer Erde ist dramatischer und urtümlicher, der zweite Schöpfungstag im Übergang zum dritten, an dem das Land vom Wasser getrennt wird.
All das wunderlich gepaart mit unserem Kaffeetourismus.
Wir bestellen Cappucino, die Bedienung spricht slawischen Akzent und trägt ihre Haare in modisch blonden Fransen. Fünf, sechs Rentnerpärchen auf dem Deck, in Corona-gemäßen Abständen
„Zum ersten Mal seit Tagen Sonne“, sagt Hürlimann aufgeräumt, sie bricht aus einem griechisch-blauen Himmel und erheitert die Sinne, so dass wir ins Blödeln geraten, er über einen Kalauer von Benn („die schönsten Gedichte der Menschen, das sind die Gottfried Bennschen“), ich über Rilkes schlechten Mundgeruch, während er seiner Alma Mahler die Zeile hauchte „Oh ihr Zärtlichen tretet zuweilen/ in den Atem der euch nicht meint…“, schließlich Gelächter über das entsetzliche Schwäbeln Schillers (gemeinsam), der sich für einen großen Schauspieler hielt, heitere Gehässigkeiten über die ganz Großen aus der literarischen Waschküche.
Ich bin bewaffnet mit Hürlimanns soeben erschienenen Essay-Band „Abendspaziergang mit dem Kater“, einer funkelnden Schaffens-Summe, einem Bilanzbuch rechtzeitig zu seinem 70.Geburtstag.

Es beginnt mit einer Betrachtung über das Schreiben – ein überaus schmerzhaftes Beginnen. Die Kloster-Schüler sollten hinaus und über Gegenstände ihrer Wahl schreiben, Hürlimann nahm sich eine Baumgruppe vor, sieben Linden, die er als Natur-Kathedrale beschrieb, errichtet aus Luft und Licht, getragen von uralten Säulen. Schön.
„Walafried hieß der Pater“, erzählt Hürlimann auf dem Deck, und genießt den Namen, „der beorderte mich in sein Büro und wollte wissen, wo ich das abgeschrieben habe.“ „Von niemandem!“. Pater Walafried rief erbost, „Du abgefeimter Lügner!“, und jetzt gerät Hürlimann in nachgeholte Empörung, „da wurde er so wütend,“ er holt aus, „dass er mich mit dem Lineal auf die Hände schlug, das hat richtig weh getan!“
Walafried schlug weiter, Hürlimann blieb standhaft. Kunst verlangt nach Opfern, Charles Bukowski ließ auf seinen Grabstein schreiben „don’t try“, versuch‘s erst gar nicht, aber der Knabe Thomas Hürlimann sagte sich ‚jetzt erst recht‘ und ließ, gerade mal 16, ein Theaterstück folgen, in dem die Hauptfigur, ein Adliger, der die französische Revolution im Erdinneren überstanden hat, nach seinem Wieder-Auftauchen nur noch an der Decke gehen kann.
Der Dramaturg am Zürcher Schauspielhaus sah ein Aufführungsproblem. „Das ist ein Stück für den Zirkus.“
In die Berge getupfte Almwiesen, das Wasser schimmert so smaragdgrün wie das an der dalmatischen Küste, das Ufer-Dörfchen Sisikon, sonnig in einen Spalt der Voralpen gewürfelt, der den Blick freigibt auf die ferne weiße Pyramide des Uri-Rotstocks, hier unten gedeihen Kiwis, ein Tropennest am 12 000 Jahre alten Gletschersee aus der Eiszeit, die Natur macht was sie will, mein Verdacht: alle Schweizer sind schwindelfrei.

Gute zwölf Jahre lang, erzählt Hürlimann, beschäftigte ihn die Erstfassung seiner „Heimkehr“, bis er sie, beflügelt durch ein Rauscherlebnis, zu jener absurden Leichtigkeit hochschrieb, dass er sie loslassen konnte. Gegen die Schmerzen seiner krebsbedingten Prostata-Verschlüsse hatte er Morphium genommen, das sein zehn Jahre jüngerer Bruder, der an Krebs verstarb, hinterlassen hatte, und das er nun an sich selber ausprobierte. Die Wirkung: ein magischer touch, eine hinreißende Aussöhnung mit allen irdischen Widrigkeiten und Widersprüchen, und dieser touch ermutigte ihn zur Neufassung seines Romans.
Nachdem er beim Überqueren einer Straße – schwer beschwingt – fast von einem Auto überfahren worden war, schmiss er das Fläschchen weg.
Seinem über alles und allen geliebten Bruder aber hatte er erneut zu danken, denn er war es, der ihn überhaupt ermuntert hatte, zu schreiben, das ganz Eigene zu schreiben.
Die bewegendsten Zeilen in seinem Essayband gelten dann auch seinem Bruder Matthias, der am 7.Februar 1980 „aufhörte, zu leben und zu sterben“. Da ist sein Tagebucheintrag über die Schwelle, die keine ist nach Hölderlin, denn „Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben“, und wenn es eine Erfahrung gibt, die Thomas Hürlimann in den letzten Jahren durchpulste, ja in ihm oszillierte, dann war es dieser innere Grenzgang.

Die Fähre biegt hinüber zur Schattenseite des Sees, in eine dunkelgrünen Stille, und dann, fast auf Blickhöhe von unserm Oberdeck die berühmteste Wiese der Welt, die des Rütli, auf der sich die geheimen Verschwörer aus den Kantonen Uri, Schwyz und Unterwalden trafen, um den Tyrannenmord zu planen und sich des gegenseitigen Beistandes zu versichern.
Die Eidgenossen. Mörder. Unterdrückte, die ihre Ketten sprengen. Revolutionäre, die Friedrich Schiller, der deutsche Freiheitsdichter, seinen Deutschen zum Vorbild gab, im letzten Drama vor seinem Tod, Goethe hatte ihm den Stoff, den er zum Roman ausarbeiten wollte, geschenkt.

In seinem Buch „Wilhelm Tell für Schüler“ deutete Max Frisch das Denkmal nach einer frühen Anregung seines Freundes Bert Brecht neu („privater Meuchelmord ist nie eine Lösung“) und demontierte das Schillerstück als „Agitprop des deutschen Idealismus“ und Hürlimann kommentiert trocken: „Es war halt diese typische sozialdemokratische Sauce, die er drüber gekippt hat.“
Es dunkelt über der Wiese. An der Uferstelle Rütli steigt ein Corps aus Soldaten in Kampfmonitur zu. Wird hier immer noch der Schwur geleistet? Hürlimann lächelt. „Nun, die Schweizer ziehen aus dem Mythos immer noch ihren Nektar, aber die Bereitschaft ist mittlerweile groß geworden ist, sich irgendwelchen Diktaten aus Brüssel zu unterwerfen.“

Die unabhängig stolze Schweiz jetzt auch im sozialdemokratischen Treibsand?
Der Bundesbrief von 1291 gilt als Gründungsdokument der Eidgenossenschaft. Gefeiert wird der Unabhängigkeitstag am 1. August. Hürlimann war vor drei Jahren eingeladen, die allfällige Ansprache zu halten, und er erinnerte darin überaus komisch an jene, die sein Vater einst im Familienkreis übte und schließlich hielt, mit dramatisch gereckter Schwurhand: „Miteidgenossen!“
Seine konnte er wegen der Krankheit nicht halten, nur einreichen. Sie ist nicht pathetisch, sondern scharf, er spricht er über die „Toleranz“, die Ideologie der Feigheit. Er spricht über den neuen Gessler-Hut politischer Korrektheit und der gendernden Sprachverhässlichung. „Eine Gesellschaft, der es sprachpolizeilich untersagt wird, sich auf die eigenen Werte und die eigene Geschichte zu berufen, hat zu sterben begonnen.“
Sein Vater, Bundesrat Hürlimann, der 1994 starb, war Regierungschef der Schweiz 1979, Chef der christlichen Volkspartei, die nach ihm in die Bedeutungslosigkeit rutschte, eine übermächtige Familien-Figur, selber einst Kloster-Zögling in Einsiedeln und tieffromm, sein Spottname in der Studentenverbindung Corvina war „Tiger“.
In Hürlimanns Roman „Der große Kater“ (verfilmt mit Bruno Ganz) wird er als ein solcher unbarmherzig herausgemeißelt. Er gab kurz nach dem Tod seines Sohnes Matthias seine Ämter ab. „Aber er verbat sich jede geäußerte Trauer, das Jammern, verbat es sich und der Familie, denn er glaubte an den göttlichen Heilsplan.“ An den und, folgt man der Wahrheit des Romans, an seine Karriere.

Gelb oben im Hang leuchtet das Grand-Hotel Sonnenberg, Schauplatz von Hürlimanns geradezu Loriot-komischer Geburtstagsfeier für den Dichterfürsten Gottfried Keller unter dem Titel „Dämmerschoppen“, der Jubilar möchte unerkannt auf der Terrasse sitzen vor seinem Schoppen, der Kellner witzelt über Kellers pathetisches „Trinkt oh Augen, was die Wimper hält…“, unverschämter Kerl, aber der Dichter gibt ihm düster recht, bis dann doch die insgeheim vorbereitete Party beginnt, die Freudenfeuer auf den Hügeln brennen und der nichteingeweihte Kellner zum servilen Wicht wird.
Heute wird das Hotel betrieben von den Leuten des Beatles-Gurus Maharishi, einem anderen Levitationsmeister.
Zurück zur Station Brunnen, und nicht lang darauf sitzen wir in einem Fährhaus auf dem Zuger See, das Hürlimann von Verwandten als Wohnung zur Verfügung gestellt wurde. Er muss in der Nähe seines Arztes leben.

Welche Lichtfluten, die da an diesem Oktober-Nachmittag durch die bodentiefen Fenster fallen! Trinkt oh Augen von dem goldnen Überfluss der Welt – danke Keller! Kristallfunken auf dem See, ein Tisch, zwei Stühle und die Goethe-Gesamtausgabe im Regal als Raumtrenner.
Aus dem Kühlschrank wird ein Dom Perignon, Jahrgang 1960, hervorgezaubert, ein so funkelnder Tag muss gefeiert werden. Schwebend sprechen wir nun über die Grenze, die Tür nach drüben, über seine Nacht der Operation. „Sehen wir uns morgen wieder“, fragt er den Arzt bang am Abend vorher. „Ich hoffe es“.

Als er gegen 4 Uhr morgens vorbereitet wurde, war er ruhig geworden. „Da war eine Frömmigkeit nach beiden Seiten“. Mit der gelebten Welt war er versöhnt, und von der anderen war er plötzlich überzeugt. „Das war keine philosophische Überzeugung, sondern die Wahrheit einer Empfindung. Ich habe mich fast gefreut. Die Toten waren bei mir. Die Großmutter, mit der ich als Kind gesprochen habe.“
Für die Operation Hürlimanns Schwester Gabrielle den ostdeutschen Professor Dr. Bachmann aufgetrieben, den Schweizer Ärzten war der Eingriff zu riskant, die zweite Op hatte alles zerbombt, aber dieser Arzt, der in Basel praktiziert, war bereit. Vor dem Eingriff hielt er Rücksprache mit seinem einstigen Chef. „Der war in Stalingrad.“

Lachen, wir stoßen wieder an, auf das Risiko Leben, vielleicht auf den Tod, ganz sicher auf das Geheimnis, und wir sprechen plötzlich über den Sturz der Kirchen in die platte Geheimnislosigkeit, über den Liturgie-Verfall, die Selbstaufgabe des Schwebens.
Hürlimann: „In dem Moment, als der Altarblock in die Mitte geklotzt wurde und die Priester ihr Gesicht zeigten, wurden sie haftbar.“ Sie waren nicht mehr Mittler, sondern ganz gewöhnliche Jochens oder Ulfs, die da herumstanden, die meisten mit einer politischen Botschaft. „Das ist ihnen schlecht bekommen“.
Wir lachen höhnisch darüber, muss am Dom Perignon liegen.
Mittlerweile hat das Naturtheater vom Zuger See noch einmal mächtig mit dem Sonnenuntergang angegeben, der edle Champagner ist verkostet und wir brechen auf, um eine weitere Schweizer Legende zu besichtigen, diesmal von innen, nämlich den Gasthof zum Ochsen, den der deutsche Weltbürger Goethe frequentierte, der wiederum vom jungen Gottfried Keller vergöttert wurde – „vierzig Tage lang“ las er ihn, alles was erreichbar war, besonders aber den „Wilhelm Meister“

Nicht die schlechteste Ahnengalerie, die sich da auftut hinter Hürlimanns epochaler „Heimkehr“ mit ihren knapp 600 Seiten, doch will er sie nicht am „Grünen Heinrich“ messen lassen, höchstens im Sinne eines vertrackten biografischen Zahlenspiels. „Beide haben wir unseren Roman zweimal geschrieben, in zwei Fassungen. Keller hat beide veröffentlicht, ich nur die zweite.“
Von der ersten, die lange lag, war er nicht überzeugt. „Sie war so etwas wie die Alters-Fassung, überlegt und übersichtlich. Dann geriet ich in die Krebs-Geisterbahn, erlebte eine Art Auferstehung und fing danach mit dem Roman von vorn an.“
Und das ist die Pointe: „Ich schrieb also die wilde Jugend-Fassung, anders als Keller, erst im zweiten Anlauf.“
Tatsächlich sitzt mir da im edlen Restaurant, Holztäfelung, Bernsteinlicht, ein ziemlich jugendsprühender und lachgeneigter Hürlimann gegenüber, und er macht dem Kellner Angst mit der Bemerkung, ich sei ein gefürchteter deutscher Restaurantkritiker. Und prompt bleibe ich in der Rolle und bestelle genau das, was nicht mehr vorrätig ist: Ochsenschwanz.

Wie durch ein Wunder wird dann doch noch einer aufgetrieben, Hürlimann bestellt Reh und sorgt für einen wunderbaren roten Merlot Amoroso. Ich überdrehe meine Rolle ins Komische und lasse den Bluff platzen, der Kellner lacht erleichtert mit, und wir haben Zeit für einige letzte Fragen in unserer Aufführung des „Dämmerschoppen“.
Max Frisch oder Gottfried Keller?
„Keller“.
Dürrenmatt oder Robert Walser?
„Früher Walser. Unerreicht in der Schweiz des 20.Jahrhundert. Ein Original-Genie. Letzthin aber die „Stoffe“ von Dürrenmatt. Das ist ebenfalls ein Ergebnis der Krankheit. Ich bin als Leser unduldsamer geworden. Was ich früher toll fand, stört mich heute: Walsers Manierismus.“
Der Journalist Marx oder der Biograf Augustinus?
„Es fällt mir zwar schwer, für Augustinus zu sein, der uns in die Finsternis der Erbsünde gestoßen hat. Auch seine Gnadenlehre macht mir Mühe. Aber was er in den „Bekenntnissen“ über die Zeit sagt, gehört wohl zum Besten, was im Abendland je gedacht und geschrieben wurde. Also Augustinus.“ Das elfte Kapitel, klar, dass es einem Platoniker wie Hürlimann gefallen muss.
Zu guter Letzt noch einmal zur Schweiz. Täuscht der Eindruck, dass es hier einen Linksruck gibt?
„Man begegnet ihm nicht unbedingt geballt, aber die Luft hat sich verändert. Bisher dachte ich immer, wir Schweizer hätten ein Freiheits-Gen. Das war vermutlich ein Irrtum. Auch hierzulande träumen die Intellektuellen und viele, vor allem linke Politiker davon, sich in eine sowjetisierte EU einzuordnen. Das heißt, wir geben auf, was das Beste an unserer Politik war, nämlich von unten nach oben, sprich von der Gemeinde her, zu politisieren und zu handeln.“
Tatsächlich wäre das eine Achsenverschiebung ins Autoritäre, die sich im großen deutschen Nachbarland längst vollzogen hat. Aber warum soll es der Schweiz da besser gehen? Andererseits: Warum nicht?
Bei uns sind es die Ostdeutschen, die widerständig sind, und die uns daran erinnern, was demokratisch möglich ist. Hürlimann nickt, seine einstige Lebenspartnerin stammt aus Ost-Berlin.
Noch einmal insistiert er: Vom Kleinen ins Große. Das ist der Schweizer Weg, erst das Dorf, dann der Bund. „Eine Nation, die sich in kleinen Räumen organisiert, stimmt auch im Großen; sie setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die sich gegenseitig korrigieren und ergänzen. Zudem kann sie niemals nationalistisch sein – sie orientiert sich ja nicht am Nationalen, sondern am Regionalen.“
Jetzt steigert er sich zur Wahlkampfrede, das Hürlimann-Gen: „Neuerdings wollen uns die Main-Stream-Medien einreden, nur von oben, also von den Bürokraten und Funktionären, könne eine Veränderung der Schweiz und der Welt zum Besseren durchgesetzt werden. Dieser Irrtum wird das politische Experiment Schweiz beenden.“
Und das wiederum, denken wir hier unten beeindruckt, wäre schade, denn wir kulturkonservativen Freigeister schauen neidisch hinüber in die Schweiz.
Im Übrigen ist der Ochsenschwanz hervorragend.
Es wird schon wieder spät und wir schweben beide, wobei der Amoroso hilft, und dann lässt sich Hürlimann von Fans, die ihn erkannt haben, durch die Zuger Nacht zurück nach Hause fahren.
Kämpfen Sie mit!
Wie Sie sicher gesehen haben, kommen meine Beiträge ohne Werbung aus. Daher: wer mich in meinem Kampf gegen eine dumpfe Linke, die auf Binnen-Is und Gendersternchen besteht, aber Morddrohungen nicht scheut, unterstützen möchte, besonders für allfällige gerichtliche Auseinandersetzungen, kann es hier tun.
