Nachdenken über Matussek und seinen Roman “Armageddon”
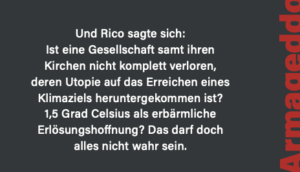
Als mein Grossvater eines Morgens im Verlagshaus des ehemaligen „Berner Tagblatt“ zu den Aufzügen kam, wartete dort bereits ein Mitarbeiter aus der Druckerei. „Fahren wir zusammen?“, fragte mein Grossvater, worauf der andere antwortete, soweit es ihn betreffe, fahre er immer zusammen, wenn er ihn sehe.
Wie dumm es wohl gewesen wäre von diesem Mitarbeiter, wenn er abgelehnt hätte mit den Worten: Sie sind mir zu groß oder zu klein, zu links, zu liberal, zu rechts, wie es im derzeitigen Fahrstuhlbetrieb wohl üblich ist! Er hätte sich womöglich um eine fruchtbare Erfahrung gebracht.

Ähnlich wie diesem Mitarbeiter ist es mir ergangen, als ich gebeten wurde, ein paar Worte zu dem kürzlich im Europa-Verlag erschienen Buch „Armageddon“ von Matthias Matussek zu schreiben. Sei’s drum – ich las und hatte in zweierlei Hinsicht ein Déjà-vu: Zum einen in Bezug auf den Autor: Wie Solschenizyn ist Matussek, dessen Arbeit und Werk ich erst vor sieben Jahren kennenlernte, in meinen Augen einer der wenigen ganz Grossen seines Fachs im deutschsprachigen Raum. Seine berufliche Vita spricht für sich. Bezeichnend für die Alleinstellung seiner Texte ist die Fähigkeit, diese Grösse in einer solchen Absolutheit in den Dienst des Gegenstands oder des Menschen zu stellen, über den er schreibt, dass sie dahinter verschwindet. Und dass der Autor, wenn er doch einmal aus den Kulissen heraustritt mit seiner Sprachberserkerei, seinen Narzissmen und Egozentrismen, seiner manischen Schaffenslust und dem Sog seiner Abgründe, dies mal quecksilbrig zart, mal polternd aber immer verdichtet vorwärtsdrängend nur dort tut, wo er das Andere grösser macht. Der Maler Manuel Gil Dorado sagte einmal zu mir, erst was einer nach Jahren und Jahrzehnten, nach tausenden Stunden staubtrockener, disziplinierter und blutenden Arbeit aus jedem Winkel perfekt zeichnen könne, vermöge er auch als lebendige Skulptur zu reproduzieren. So sind Matusseks Texte alle – auch der jetzt vorliegende autobiographische Roman „Armageddon“: Lebendig.

Nach Solschenizyns „Archipel Gulag“, „Der erste Kreis der Hölle“, „Krebsstation“ und „Iwan Denissowitsch“ irritierte mich das biographische Werk „Die Eiche und das Kalb“ zuerst. Was war das? Ich wusste es nicht. Genauso im Fall von „Armageddon“ – ich wusste nicht, womit ich es hier zu tun hatte. Ein autobiographischer Roman? Eine „Kropfleerung“, wie man in der Schweiz sagt? Eine Suche? Ein Bekenntnis? Klar war einzig: Hier trat mir nicht mehr exklusiv das Produkt dieses Grossen entgegen, der selber im Hintergrund und damit sozusagen jenseits von gut und böse bleibt, sondern der Grosse selbst: Matthias Matussek, der vom Sockel steigt, auf den ich ihn gestellt hatte, und der mir im Wortsinn kampflustig sein eigenes Gut und sein Böse vor den Latz knallt. Man hat es mit Nähe zu tun. Mit Intimität und ihrer ganzen menschlichen Fracht. Mit einem Autor, der nicht mehr jedes Gran an Können und Kraft darein setzt, von sich weg- und auf das Andere zuzuschreiben, sondern der auf einmal auf sich selber hinschreibt und damit, von Mensch zu Mensch, auch auf den Leser hin. Hier geht es um ihn selber und damit wird auch meine Sache verhandelt. Ehe, Familie, Freunde, Feinde. Bitterkeit, Enttäuschung, verweigerte Ehre, Tod, Verzweiflung. Liebe. Für den Distanzfanatiker in mir eine Herausforderung. Für den Gelegenheitsmisantropen ein Fest. Was „typisch Matussek“ bleibt bei aller ungewohnten Nähe: Der Sog. Und die Dichte. Man liest das Buch in einem Zug durch und merkt – rasend unterhalten – nur am Rande oder besser: am Ende, was für ein Kondensat an Information, Erfahrung und Wissen man hier quasi nebenbei mitnimmt.

Das zweite Déjà-vu verdanke ich der Tatsache, dass ich gerade drei Monate des totalen Medienverzichts hinter mir habe. Was Matussek als tatsächliches Geschehen der Gegenwart schildert, „seine“ Branche mit ihren Böhmermanns, Diekmanns und Stuckrad-Barres, die vielgesichtige Feigheit derer, die „noch an der Klippe der Salonfähigkeit hängen“, und schliesslich die Angriffe auf seine Person und Familie bleiben in der Distanz eines „Dort und Dann“. Und werden gerade dadurch in der Schärfe ihrer vernunftfeindlichen Groteske und in ihrer bösartigen Absurdität sichtbar, die eine Zeit und eine Gesellschaft vor sich hintreiben, die, eingeklemmt zwischen Vergangenheitshass und Zukunftsangst, triebhaft und gefühlsgesteuert an eine absolute unentrinnbare Gegenwärtigkeit gekettet bleiben. Und es braucht schon die Grösse eines Matussek, die feinen Antennen seiner manchmal fast cholerischen Lebens- und Menschenbejahung, um das niederschmetternde Mittelmass eines abgekupferten Neu-Göbbeltums zu erkennen, das sich nicht sich selbst, sondern einzig der Protektion einer Meute politischer Gauner verdankt. Die Produzenten einer „Kunst“, die sich in der Hässlichkeit von Bosheit, Häme und feigem Revoluzzertum erschöpft; die Stars einer Medienwelt, die sich nicht zu schade ist, „Nachrichten“ oder „News“ zu nennen, was nur Mobbewirtschaftung im Dienst der Politik ist.

„Armageddon“ lässt thematisch wenig aus, was die Dekonstruktion und Tod verherrlichende Gegenwartskultur ausmacht. Zwei wiederkehrende Schwerpunkte sind erkennbar – zusammen bilden sie eine Art Grundthema: Der Verrat und der Tod. Matussek thematisiert ihre reale Allgegenwart im persönlichen Leben und im politischen Heute ebenso, wie ihre Degradierung als Worte zu perversen, mit Un-Sinn angefüllten Begriffsattrappen; ihre Vertrauens- und damit Freiheitszerstörende Kraft, ihren Lebens- und Freudefrass überall dort, wo es nur ein Ich, ein Hier und ein Jetzt gibt, in dem der Mensch du-los sich selbst überlassen ist und der Himmel leer bleibt. Was Matussek zu diesen Themen in das Buch reinpackt, die beeindruckende Fülle an Stimmen, die er herbeizieht, um die dargelegten Erkenntnisse abzusichern, verlangen nach einer zweiten Lektüre. Dann nach einer dritten. Hier schreibt nicht mehr nur der begnadete Erzähler und Chronist, sondern der Mensch als noch Suchender und doch schon Heimkehrender – einer, der heute aus der Erfahrung eines Lebenswegs, der im schwärmerischen Marxismus seinen Ausgang nahm, weiss, dass es eine Wahrheit geben muss und eine Wirklichkeit, eine verlässliche Ordnung und Grenzen, wo Leben und Zusammenleben nicht sinnlos ins Leere laufen und unter das Primat der Moden willkürlicher Moral, sondern unter das der Freiheit und der Freiwilligkeit gestellt werden sollen.
Neben diesen zwei – Verrat und Tod – gibt es noch ein Drittes. Ein Autor und Leben gleichermassen umfassendes Drittes. Wie ein Ozeanriese in unruhiger See seinen Treibanker, so schleppt der Sprachriese Matussek dieses hinter sich her – Widerstand, Bremse, Stabilisator: seinen christlichen Glauben. Die Wand bei seinem Schreibtisch steht symbolisch dafür: Das Hochzeitsfoto, die Ikone, der Drachentöter – sein eigenes „bewaffnetes Bündnis gegen die Aussenwelt“ (Chesterton). Liebe, Glaube, Hoffnung. Sie sind in allem hör- und sichtbar, was Matussek beschreibt. Und sie sind der Grund, warum „Armageddon“ – im Realen ebenso, wie im Fiktiven – nicht den Eindruck von Ausweglosigkeit hinterlässt, sondern – paradox genug – den Trost des biblischen „Dennoch“.
Und jetzt vergessen Sie bitte all das oben Geschriebene wieder: Es sagt mit grosser Wahrscheinlichkeit – Schicksal all der Kleinen, die über Grössere schreiben – mehr über mich selber aus, als über den Autor von „Armageddon“. Behalten sie bloss die möglichen Antworten auf die Frage im Kopf, was es denn nun sei, dieses Buch: Es ist ein Roman. Aber es ist ebenso autobiographisches Bekenntnis, Liebeserklärung, Abrechnung, Anklange und Warnung. Vor allem aber ein eindrückliches Zeitdokument.

Kämpfen Sie mit!
Wie Sie sicher gesehen haben, kommen meine Beiträge ohne Werbung aus. Daher: wer mich in meinem Kampf gegen eine dumpfe Linke, die auf Binnen-Is und Gendersternchen besteht, aber Morddrohungen nicht scheut, unterstützen möchte, besonders für allfällige gerichtliche Auseinandersetzungen, kann es hier tun.
